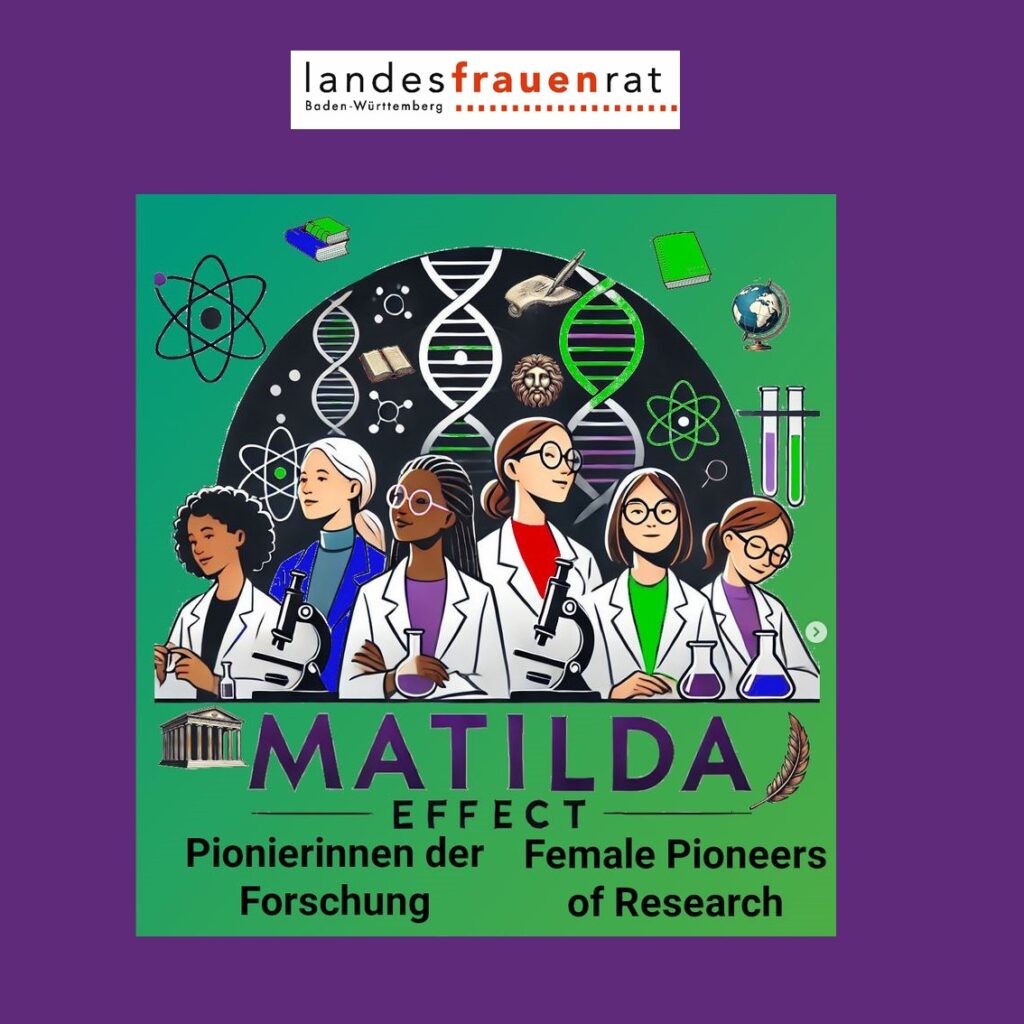
Bildrechte@KIT
Der Matilda-Effekt ist ein Begriff aus der Wissenschaftssoziologie, der ein systematisches Phänomen beschreibt: die wiederholte und strukturelle Geringschätzung oder Unsichtbarmachung der wissenschaftlichen Leistungen von Frauen, insbesondere wenn ihre Arbeit Männern zugeschrieben wird.
Der Begriff wurde von der Wissenschaftshistorikerin Margaret W. Rossiter geprägt. Sie benannte ihn nach Matilda Joslyn Gage, einer US-amerikanischen Frauenrechtlerin, die schon 1893 auf die „beklauten Frauen in der Wissenschaft“ hingewiesen hatte.
Der Matilda-Effekt ist kein rein historisches Ereignis, sondern Ausdruck eines strukturellen Problems in der Wissenschaft, besonders in den MINT-Fächern, in denen Frauen trotz herausragender Leistungen häufig übersehen und übergangen werden oder im Schatten ihrer männlichen Kollegen bleiben.
Zum Beispiel Rosalind Franklin (1920–1958): Ihre Röntgenaufnahmen der DNA, insbesondere das berühmte Foto 51 im Jahr 1952, waren entscheidend für die Entdeckung der Struktur der DNA-Doppelhelix. 1953 veröffentlichten James Watson und Francis Crick gemeinsam mit Maurice Wilkins ihre Ergebnisse. Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin wurde 1962 ausschließlich an die drei Männer vergeben – Rosalind Franklin wurde dabei nicht berücksichtigt, obwohl ihre Arbeit maßgeblich zum Durchbruch beitrug. Sie war zu diesem Zeitpunkt bereits seit vier Jahren verstorben.
Und auch heute noch manifestiert sich der Matilda‑Effekt in Karriereverzögerungen, Zitationslücken, Anerkennungsdefiziten und förderpolitischen Ungleichheiten. Regelmäßig weist der Landesfrauenrat Baden-Württemberg auf strukturelle Ungleichheiten und Gender Bias hin und fordert gemeinsam mit vielen Protagonist:innen, dass diese Missstände beseitigt werden.
Aus diesem Engagement heraus entstand auch die Idee zur Digitalen Landkarte der Frauenerinnerungsorte in Baden-Württemberg auf der Homepage des Landesfrauenrats Baden-Württemberg https://www.lfrbw.de/themen/frauenerinnerungsorte/
Mit dieser interaktiven Karte werden Orte gebündelt und sichtbar gemacht, die an das Wirken und die Leistungen von Frauen in Baden-Württemberg erinnern. Ziel ist es, diese Beiträge zur Geschichte und Gegenwart stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und die Schaffung weiterer Frauenerinnerungsorte aktiv zu fördern.
In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen heute die Reihe „Pionierinnen der Forschung“ des Projekts BESSEr@KIT am Karlsruher Institut für Technologie vorstellen. Auf dem Instagram-Kanal @besserkit finden Sie inspirierende Beiträge über internationale Wissenschaftlerinnen und Autorinnen, deren Leistungen lange Zeit unbeachtet blieben. Wir laden Sie ein, in diese eindrucksvollen Geschichten einzutauchen und mehr über jene Frauen zu erfahren, die trotz struktureller Barrieren und systemischer Benachteiligung, Wissenschaft und Gesellschaft nachhaltig geprägt haben.
In Zeiten, in denen Geschlechtergerechtigkeit noch immer keine gelebte Realität ist und wir uns zunehmend mit Rückschritten in frauenpolitischen Errungenschaften konfrontiert sehen, ist die kritische Auseinandersetzung mit Teilhabe, Sichtbarkeit und Machtverhältnissen dringlicher denn je. Es genügt nicht, historische Ungleichheiten zu benennen – es braucht mutige politische Maßnahmen, verbindliche Gleichstellungsziele und eine konsequente Umverteilung von Ressourcen und Einfluss.